Es hätte doch alles so schön werden können - eine Rezension der anderen Art | Teil 1
Von Kerstin Maria Huber
Heute stellen wir euch drei Romane vor, deren Protagonisten eine gute Prise mediativer Haltung und Kommunikationsmethoden hätten vertragen können, um Eskalation, Blut und dem gelegentlichen Einsatz des Metzgerhandwerks vorzubeugen. Aber natürlich geht es darum nicht. Konflikte sind in der Literatur Handlungstreiber und durchaus ergiebiger im Spannungsbogenbau als ein harmonisches Weltfriedensszenario. Und, vielleicht sogar noch wichtiger, werfen gerade sie nicht selten die großen Fragen auf.
Einige Klassiker und auch neuere Erscheinungen durch die mediative Werkzeugbrille zu betrachten, ist daher nicht nur spannend, durchaus unterhaltsam oder macht sich gut auf der Metaebene. Es sind ferner bilderreiche Beispiele dafür, wie schnell, nachhaltig oder grotesk Konflikte eskalieren können. Indirekt stellen sie so auch immer wieder die Frage nach dem Selbst und dem Miteinander.
Gabriel García Márquez: Chronik eines angekündigten Todes
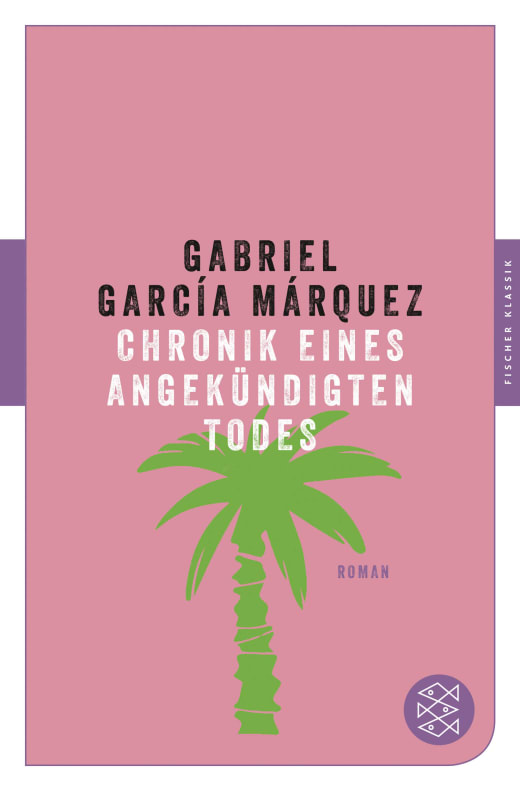
Gabriel García Márquez: Chronik eines angekündigten Todes
Übersetzt von Curt Meyer-Clason
Frankfurt a.M.: FISCHER Taschenbuch
2019
128 Seiten
978-3-596-90706-9
„Ironisch, komisch, zärtlich und grausam. Eine ‚klassische‘ Erzählung von weltliterarischem Format des kolumbianischen Literaturnobelpreisträgers Gabriel García Márquez.
Ein ganzes Dorf feiert Hochzeit. Es ist ein rauschendes Fest. Doch noch in der Nacht schickt der Bräutigam die Braut zurück ins Elternhaus. Sie war nicht mehr unberührt. Um die befleckte Ehre ihrer Schwester wieder herzustellen, ziehen die Brüder der Braut noch in derselben Nacht los, mit geschliffenen Messern. Der mutmaßliche ‚Täter‘ Santiago Nasar muss sterben. Die Apathie eines ganzen Dorfes und eine Reihe unglücklicher Zufälle weben das Netz der Fatalität, aus dem es für das Opfer kein Entrinnen mehr gibt.” (S. Fischer)
Márquez‘ Roman ist eine lyrische Tour de Force im Prosaformat, zum Ende hin angereichert mit einem Finale quellender Eingeweide. Keiner hört zu, niemand fragt nach, jeder hat so seine eigene Agenda und Weltsicht und – mit am interessantesten – geht bequemerweise davon aus, dass schon jemand anderes das Ganze aufklären, weitererzählen und regeln wird. In diesem schlanken Büchlein, das nur einen sehr kurzen Zeitraum beschreibt, hat definitiv die komplette Erlebniskette Kommunikation versagt.
Juli Zeh: Unterleuten
Juli Zeh: Unterleuten
München: btb
2017, 15. Auflage
643 Seiten
978-3-442-71573-2
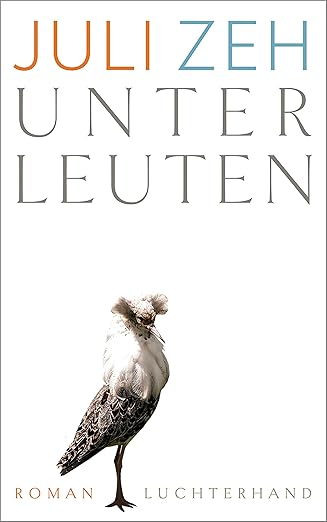
„Manchmal kann die Idylle auch die Hölle sein. Wie das Dorf „Unterleuten“ irgendwo in Brandenburg. Wer nur einen flüchtigen Blick auf das Dorf wirft, ist bezaubert von den altertümlichen Namen der Nachbargemeinden, von den schrulligen Originalen, die den Ort nach der Wende prägen, von der unberührten Natur mit den seltenen Vogelarten, von den kleinen Häusern, die sich Stadtflüchtlinge aus Berlin gerne kaufen, um sich den Traum von einem unschuldigen und unverdorbenen Leben außerhalb der Hauptstadthektik zu erfüllen. Doch als eine Investmentfirma einen Windpark in unmittelbarer Nähe der Ortschaft errichten will, brechen Streitigkeiten wieder auf, die lange Zeit unterdrückt wurden. Denn da ist nicht nur der Gegensatz zwischen den neu zugezogenen Berliner Aussteigern, die mit großstädtischer Selbstgerechtigkeit und Arroganz und wenig Sensibilität in sämtliche Fettnäpfchen der Provinz treten. Da ist auch der nach wie vor untergründig schwelende Konflikt zwischen Wendegewinnern und Wendeverlierern. Kein Wunder, dass im Dorf schon bald die Hölle los ist …” (Luchterhand)
Zeh verhandelt den Makrokosmos im Mikrokosmos, große Konflikte im alltäglichen Klein-Klein. Die Figuren leben gut eingerichtet in und mit ihrem subjektivistischen Weltbild und fremdeln arg mit dem Konzept des Perspektivenwechsels und dem Verstehen des anderen durch Nachfragen und Transparenz. Die eigene Haltung ist Leitmotiv und Kompass in einem und führt zu falschen Annahmen, zur stufenweisen Hoch- und Selbsteskalation und latenter Dialogaversion. Gemessen daran, dass es hier ja nur um die Sache gehen soll, geht es erstaunlich emotional und identitätsstiftend zu.
Ayelet Gunnar-Goshen: Wo der Wolf lauert
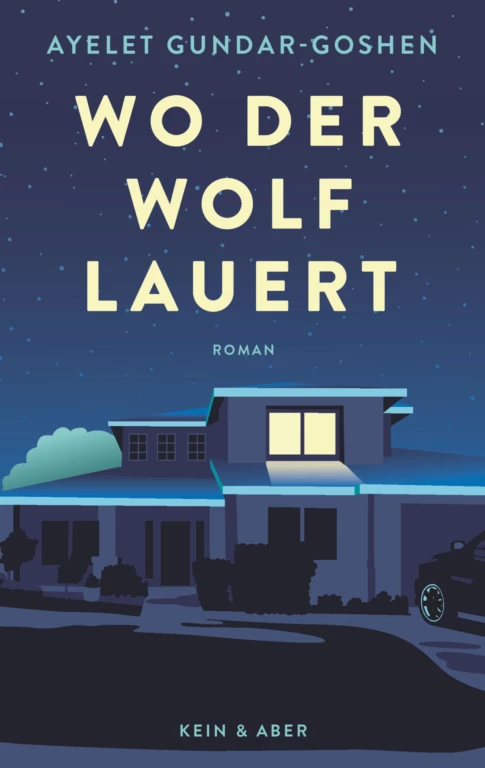
Ayelet Gunnar-Goshen: Wo der Wolf lauert
Übersetzt von Ruth Achlama
Zürich: Kein & Aber
2021
352 Seiten
978-3-0369-5849-1
„Lilach Schuster hat alles: ein Haus mit Pool im Herzen des Silicon Valley, einen erfolgreichen Ehemann und das Gefühl, angekommen zu sein in einem Land, in dem man sich nicht in ständiger Gefahr wähnen muss wie in ihrer Heimat Israel. Doch dann stirbt auf einer Party ein Mitschüler ihres Sohnes Adam. Je mehr Lilach über die Umstände des Todes erfährt, desto größer wird ihr Unbehagen: Ist es möglich, dass Adam irgendwie damit in Verbindung steht?” (Kein & Aber)
Wie gut kann man selbst seine eigene Familie kennen? Ohne Dialog wird das jedenfalls sehr sportlich. Es hätte Mutter und Sohn in Gundar-Goshens Roman gut getan, das Miteinander-Sprechen in die Adoleszenz des einen und das Sorgenwachstum der anderen hineinzuentwickeln. Die riskanter werdende Gedankenachterbahn wieder einzugleisen und die eigene Wahrnehmung in Stereotypen zu hinterfragen, wären dabei mehr als ein marginaler Mehrwert gewesen – im Persönlichen wie im Gesellschaftspolitischen. Es geht viel um fluktuierende Täter- und Opferzuschreibungen, was zumindest eine gewisse Beweglichkeit im Schubladendenken zeigt und der schwarz-weißen Farbpalette einige Grautöne beschert. TOA (Täter-Opfer-Ausgleich) – kreativ anders? Leider nein.
Fazit
Letztendlich wären diese Bücher natürlich nicht die Bücher, die sie sind, und hätten bisweilen auch nicht die Tiefenschichten und den Unterhaltungswert, den sie haben, wäre die Kommunikation eine funktionierende und der Umgang miteinander ein mediativer.
Stichwort Unterhaltungswert: der Begriff Angstlust, der die Freude und das regulierende wie hilfreiche Potential an Angst und Grusel in einem sicheren Umfeld beschreibt, wird mittlerweile gut in Biologie und Psychologie erforscht. Eine Lektüre dieser Art auf der eigenen Couch oder gemütlich in der Sonne sitzend kann daher bisweilen sehr amüsieren und eben auch unterhalten. Auch wenn, oder gerade weil das Grauen immer ein Wort entfernt ist.
