Wie sich Situationen und Personen dynamisch eskalieren lassen - eine Rezension der anderen Art | Teil 2
Von Kerstin Maria Huber
Die Buchempfehlung der anderen Art geht in die zweite Runde und lässt sich gerade in den Sommermonaten wunderbar als Ferienlektüre lesen. Auch heute stellen wir euch kurz und knapp drei Romane vor, deren Protagonisten eine gute Prise mediativer Haltung und Kommunikationsmethoden hätten vertragen können, um Eskalation, Blut und den gelegentlichen Einsatz des Metzgerhandwerks vorzubeugen. Aber natürlich geht es darum nicht. Konflikte sind in der Literatur Handlungstreiber und durchaus ergiebiger im Spannungsbogenbau als ein harmonisches Weltfriedensszenario. Und, vielleicht sogar noch wichtiger, werfen genau sie nicht selten die großen Fragen auf.
Einige Klassiker und auch neuere Erscheinungen durch die mediative Werkzeugbrille zu betrachten, ist daher nicht nur spannend, durchaus unterhaltsam oder macht sich gut auf der Metaebene. Es sind ferner bilderreiche Beispiele dafür, wie schnell, nachhaltig oder grotesk Konflikte eskalieren können. Indirekt stellen sie so auch immer wieder die Frage nach dem Selbst und dem Miteinander.
Yasmina Reza: Der Gott des Gemetzels
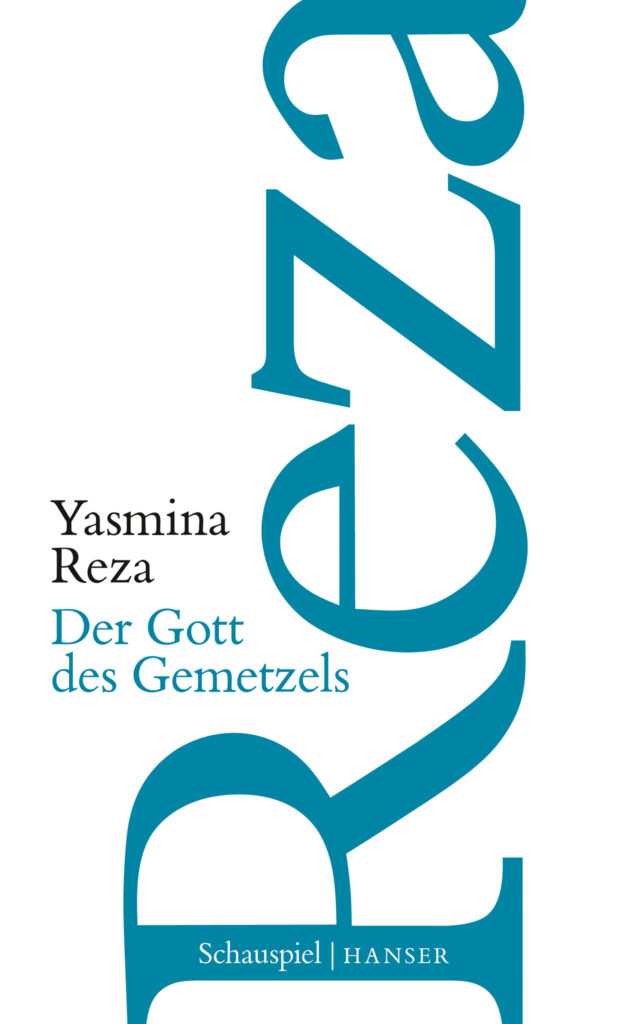
Jasmin Reza: Der Gott des Gemezels
Übersetzt von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel
München: Hanser
2018
80 Seiten
978-3-446-25886-0
„Der Gott des Gemetzels, 2006 im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt, spielt auf der Grenze zwischen Gesellschaftssatire und menschlichem Desaster. Zwei Elfjährige haben sich geprügelt, dabei schlug der eine dem anderen zwei Zähne aus. Die beiden Elternpaare treffen sich zum klärenden Gespräch. Hinter der Fassade bürgerlicher Wohlanständigkeit tun sich Abgründe auf – schockierend und komisch zugleich.“ (Hanser)
Rezas Theaterstück ist ein Kammerspiel par excellence und ein tiefschwarzer Tanz der Eskalation. Hinter der eloquenten Fassade aus Gutbürgerlichkeit und Gutmenschentum blühen aufgrund fehlender Selbstreflexion, Respektlosigkeit und aktivem Nicht-Zuhören Egoismus und Konkurrenzdenken. Der Leser kommt ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr hinterher, sein inneres Popcorn auszupacken, so rasant und bitterböse eskalieren die vier Bildungsbürger ohne wirkliche Dialogfähigkeit. Reza zeigt sprachlich fein komponiert, dass Eloquenz nichts mit Kommunikationskompetenz zu tun haben muss und Empathievermögen nicht analog zum Intellekt verläuft. Die Decke des zivilisierten Umgangs ist eine dünne, darunter greifen archaische Muster und Kämpfe wie eh und je.
William Shakespeare: Macbeth
William Shakespeare: Macbeth
Übersetzt von Dorothea Tieck
Stuttgart: Reclam
1986
112 Seiten
978-3-15-000017-5
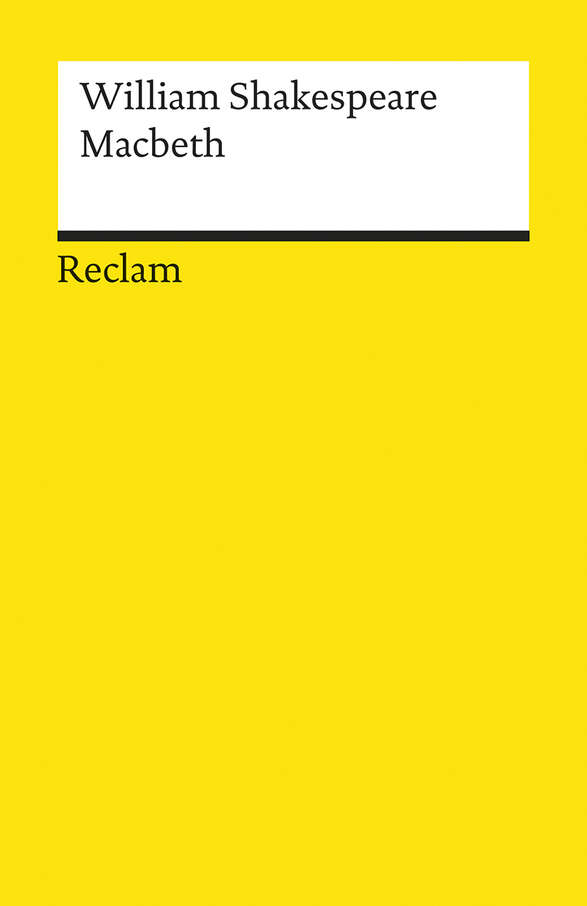
„König Duncan von Schottland verleiht seinem Heerführer Macbeth – gemäß der Prophezeiung dreier Hexen – nach dem erfolgreichen Kampf gegen Aufständische den Titel Thane of Cawdor. Dem zweiten Teil der Prophezeiung, nämlich dass Macbeth König werde, glaubt Macbeth, zusätzlich überredet von seiner Frau, nachhelfen zu müssen, indem er König Duncan ermordet. Macbeth trachtet nun allen (vermeintlichen) Mitwissern, Konkurrenten und Gegnern nach dem Leben und schreckt auch vor Mord an deren Familien nicht zurück. Schließlich setzen König Duncans geflohener Sohn Malcolm und der Edelmann Macduff dem mörderischen Treiben Macbeths in einer Schlacht ein Ende. Macbeth ist Shakespeares kürzeste, konzentrierteste und eingängigste Tragödie.“ (Reclam)
In Shakespeares Macbeth verfolgt jede Figur eine sehr eigene Agenda mit Mitteln der Affektsteuerung und Manipulation anderer. Im mythischen Element von Hexen und Prophezeiungen erhält dieser Reigen noch ein besonderes Drehmoment. Allein das auch daraus resultierende Ausmaß an schlechter Beratung und Fehlinterpretation ist erstaunlich (Stichwort: wandelnder Wald von Birnam). Transparenz und Informiertheit stehen nicht hoch im Kurs. Es hätte jedenfalls nicht geschadet, Konkretisierungsfragen zu stellen und Zahlen, Daten, Fakten zu erheben, um allein der Hexen Prophezeiungen Herr zu werden und nicht seine eigene Realität und Wunschdenken zum Leitbild werden zu lassen. Nach den Bedürfnissen hinter diesem stark ich-zentrierten und kamikazehaften Verhalten zu fragen, wäre dann jedoch wohl eher ein Fall für die tiefenpsychologische Couch als für den selbstverantwortlichen Mediationstisch.
T.C. Boyle: Wenn das Schlachten vorbei ist
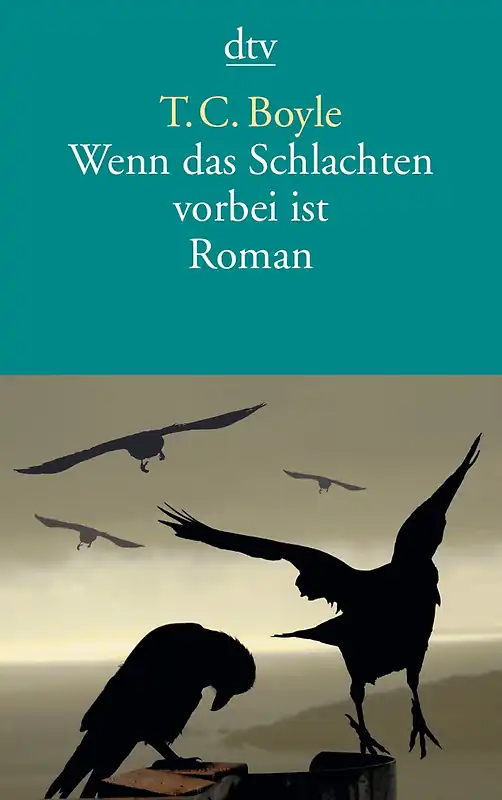
T.C. Boyle: Wenn das Schlachten vorbei ist
Übersetzt von Dirk van Gunsteren
München: dtv
2013
464 Seiten
978-3 423-14269-4
„Zwei Fraktionen von Umweltschützern liefern sich einen erbitterten Kampf. Schauplatz sind die Channel Islands vor der Südküste von Kalifornien, wo die Umwelt vom Menschen empfindlich gestört wurde. Soll man das Gleichgewicht des Ökosystems mit viel Steuergeldern wiederherstellen – was zwangsläufig die Ausrottung mancher Tierarten bedeutet -, oder soll man um jeden Preis das Töten verhindern? T. C. Boyles furioser, apokalyptischer Roman handelt von der Ausbeutung der Natur durch den Menschen und den katastrophalen Folgen. Boyle hat eines seiner ältesten Themen weiterentwickelt, nie war er so bitter und böse, nie war es ihm so ernst.“ (Hanser, dtv)
Wer für die gute Sache kämpft, hat Recht und darf sich aller Mittel bedienen? Doch welche ist die bessere Sache, wenn beide gut sind? Und das mit der Rechtfertigung der Mittel… das hat irgendwie noch nie so richtig funktioniert. Boyle setzt eine groteske Spirale der Gewalt in Gang, die stetig weiter gedreht wird und Glasls Konfliktstufendiagramm literarisch erzählt. (Gewalt-)Eskalation, Impulsivität und Dialogvermeidung sind hier die Kernelemente des anti-mediativen Handwerks. Das Fenster des Verstehens, das Finden der deutlich vorhandenen Bedürfnisschnittmenge und das wertungsfreie Brainstorming aus Phase 4 einer Mediation hätten einen neuen Lösungsraum und damit neue Chancen auf ein anderes Ende aufmachen können. Doch mit dem Konjunktiv allein gewinnt auch diese Beziehungsgestaltung keinen Blumentopf.
Fazit
Letztendlich wären diese Bücher natürlich nicht die Bücher, die sie sind, und hätten bisweilen auch nicht den Unterhaltungswert, den sie haben, wäre die Kommunikation eine funktionierende und der Umgang miteinander ein mediativer.
Stichwort Unterhaltungswert: der Begriff Angstlust, der die Freude und das regulierende wie hilfreiche Potential an Angst und Grusel in einem sicheren Umfeld beschreibt, wird mittlerweile in Biologie und Psychologie erforscht. Eine Lektüre dieser Art auf der eigenen Couch oder im Liegestuhl können bisweilen auch sehr amüsieren und eben unterhalten. Auch wenn, oder gerade weil das Grauen immer nur ein Wort entfernt ist.
